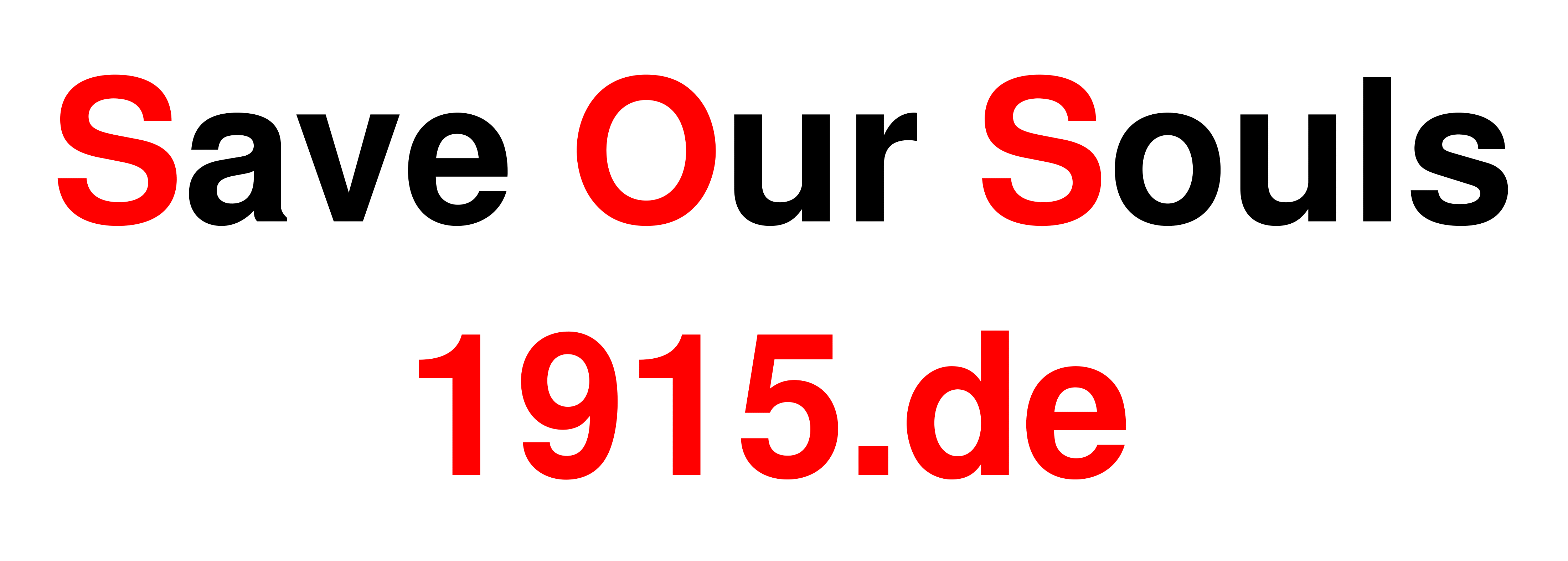In der Zelle vermischte sich der Duft der frischen Mandelblüten mit dem Schweiß- und Uringeruch der verhafteten Armeniern und Syrern im Gefängnis von Diyarbekir. Die Gefangenen der überfüllten Zellen standen abwechselnd vor dem kleinen Fenster und versuchten die frische Luft zu atmen und die Sonnenstrahlen der Mittagssonne zu fühlen. Durch das Urin- und Atemgeruch der Gefangenen roch die Zelle feucht und muffig. Die Schweißfeuchten schwarzen Haare der Gefangenen klebten aneinander. Der Urin hinterließ einen dunkelgelben Fleck um den Schlitz an der Wand der Gefängnismauer und floss draußen, vorbei an Mandelbäumen, in das klare Wasser der Ayno-Zalilto-Quelle.
Professor Ashur Yawsef hörte wieder die erschütternden lauten Schreie aus einer Zelle. Alle Gefangenen blickten auf den Boden. Konnte er, konnten alle hier, sich an das Mordsgeschrei gewöhnen?
Die Schreie drangen Minute um Minute in den Kopf der Gefangenen. Sie ließen sie keine Minute ruhen. Auf dem Gesicht mancher Gefangenen rollten Tränen vermischt mit dem Schweiß, die mehr durch Angst als durch die Hitze der Mittagssonne in der überfüllten Zelle auftauchte. Einige nahmen ihr Gesicht zwischen ihren Händen und weinten leise.
Später trockneten sie ihre Tränen und weinten in ihre Seelen.
Quietschend öffnete sich ein Spaltbreit an der Zellentür. Durch die Öffnung sah der Professor ein Blatt, Feder und Tinte. Schnell eilte er zur Tür und nahm sie zu sich. Neugierig hielt er Ausschau hinter der Tür. In der Dunkelheit konnte er nichts erkennen. Es war dunkler als in seiner Zelle. Die Spalte schloss genauso quietschend, wie sie aufging. Er setzte sich neben die Tür und freute sich auf die Feder und das Blatt Papier.
„Meinem lieben Bruder, Hanna Yusuf Yawsef.
Seit einem Tag bin ich mit vielen Armeniern im Gefängnis. Unser Bruder Donabed teilt mit mir das gleiche Schicksal. Ich freue mich, dass ich die Möglichkeit gefunden habe, dir einen letzten Brief zu schreiben. Ich schreibe ´letzten Brief´, weil ich mir sicher bin, dass wir dieses Gefängnis nur verlassen werden, um dem Tod ins Auge zu schauen.
Sei nicht traurig. Es ist Gottes Wille!
Ich bin nur in Trauer, wegen meinen Büchern, weil ich sie nicht zu Ende schreiben kann.
Meine liebe Frau und meine Kinder sind dir anvertraut.
Die Zeit läuft mir davon.
Lebe wohl mein Bruder.
Lebewohl.“
Er setzte schnell seine Unterschrift unter den Brief und wartete still vor der Tür. Er las den Brief Zeile für Zeile mehrmals durch und dann klopfte er drei Mal. Durch die geöffnete Spalte streckte er erst einen Goldring dann das gefaltete Papier, Feder und Tinte raus. Schrillend schloss sich die Spalte für den restlichen Tag.
Keiner der Gefangenen schaute in der Zeit zu ihm hin. Niemand fragte etwas. Einige von ihnen nahmen vor ihm auch schon das Stück Papier. Damit erwarben sie die Möglichkeit Lebewohl zu sagen, etwas zu hinterlassen, etwas mitzuteilen. Sie kauften damit ihre Freiheit für einen Moment, die sie weit weg von der Zelle, weit weg von dem Gefängnis, weit weg von Gendarmen um das Gefängnis laut schreien konnten.
Er hob seinen Kopf und beobachtete, wie das Sonnenlicht immer schwächer wurde. Alle Gefangenen waren mit sich selbst beschäftigt. Alle warteten auf das Unvermeidliche.
Er träumte, er ginge mit seiner Frau durch die Gassen von Omid, sie kletterten in frühen Morgenstunden die alte Mauer, von dort blickten sie zu Hasan Pascha Han, frühstückten sie dort mit ihren Kindern und gingen, um die durch Omid fließende Ayno-Zalilto, spazieren.
Ein lauter Schrei verstreute seinen Traum in alle Winde und brachte ihn zu seiner dunklen Zelle zurück. Langsam gewöhnten sich seine Augen an die muffige Zelle. Er hatte den Drang, außerhalb der Zelle an der Quelle, die Frische der Mandelblumen, tief einzuatmen. Er stand auf und nährte sich dem kleinen Fenster. Er hielt das Gitter fest und streckte seinen Kopf durch die kleine Öffnung. Eine angenehm kühle Luft wehte um sein Gesicht. Die Bilder der Bäume verschmolzen mit der Dunkelheit. Er schloss seine Augen und horchte dem leise fließenden Wasser.
Dem Tag folgte die Nacht und die Schreie aus den anderen Zellen hörten nicht auf. In den nächsten Tagen überdeckte eine rot schwarze Flüssigkeit die dunkelgelben Urinspuren.
Am 23. Juni 1915 verließ der Professor, halb abgemagert, das Gefängnis.
Viele Armenier, die er gekannt, mit denen er die gleiche Zelle geteilt hatte, hingen am Galgen. Er hielt vor den Armenieren und ging nicht mehr weiter. Mit einem spöttischen Lächeln im Gesicht drehte er sich zu der großen Menschenmenge um den großen Platz.
„Warum soll ich es leugnen: Ich bin ein Syrer und ein Christ und sterbe als Christ!“ schrie er den Versammelten entgegen.
In Würde lebte er bis zu dem heutigen Tag. In Würde wollte er sterben. In Würde lief er dem Tod entgegen.