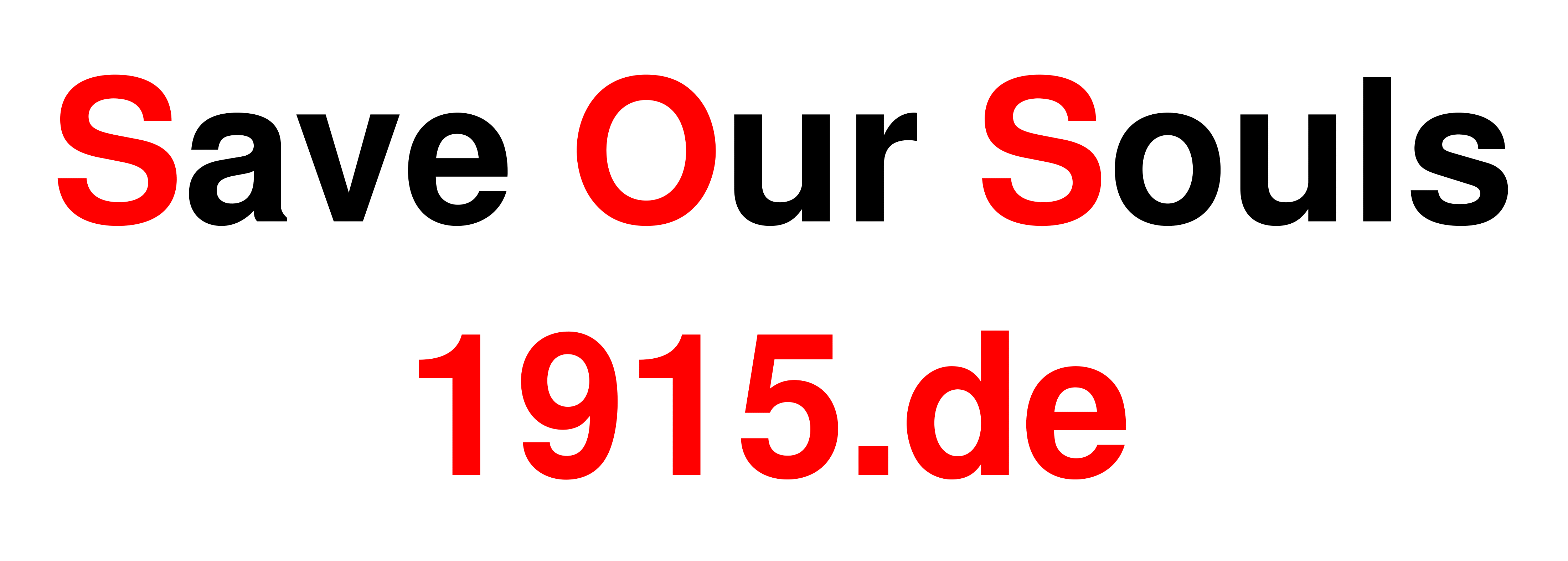Berichte von Augenzeugen und Überlebenden 1914-1922
Bericht aus The Manchester Guardian (29. Juni 1914) über die Ereignisse in der Provinz Aydin, gestützt auf “Briefe von einem Engländer, der sich gegenwärtig auf einer der ägäischen Inseln aufhält”:
“It will be seen that the writer, who is in a position to know the truth confirms the charges made by Greece against Turkey of ill-using and expelling the Hellenes settled on the Asiatic coast. The letter-writer says:
The state of the Christian villages on the coast is very terrible—all the horrors of war in peace, and these are inoffensive villagers not even accused of any offence against the Government. At Mytilene the churches are full, and there is no further accommodation, and I believe about 10,000 in all have left Chesme. A number of women and children embarked at Chesme on our steamer. They wished to get out at Smyrna, but were not allowed, and were therefore brought on here.
The moharjis (Turkish emigrants) from Europe who were brought to Chesme to expropriate the Christians were not from Macedonia, but nearly all Albanians of Gheg tribe, from Serbian territory. So the excuse of retaliation for such a supposed expropriation by the Greek Government from Macedonia cannot be offered. The whole thing (in which the Turkish Government, of course, professes ignorance and innocence) is undoubtedly a perfectly ruthless and carefully organized plot of the Committee for getting rid of the Christian population along the Anatolian coast. This is shown by the similarity of method throughout. The smaller outlying villages are first attacked, and the expropriation is there carried out by force. The larger communities are then threatened with the same dispossession by violence. The inhabitants do not, of course, await execution, but having seen it at their doors, anticipate it by leaving. It is then represented to the consuls that they left of their own accord, and had no cause for fear. If what has happened is condoned the larger communities, such as Aivali “Ayvalık, or Kydonia” and even Smyrna will no doubt be dealt with.
The Christian villages in the environs of Aivali having now been completely, village by village, cleared of their inhabitants, proceedings against Aivali itself (it contained about 30,000 inhabitants, nearly all Christian) have commenced, and the first fugitives arrived yesterday. The Kaimakam of Aivali told the inhabitants that they must go. He said, “This is no longer your country; if you don’t go to-day you will be compelled to go to-morrow.”
Stories of cruelty and outrage in the expulsion of the inhabitants from the villages— features which it was impossible indeed should be lacking—are simply confirmed. A good many girls are in the hospitals at Aivali in consequence of their treatment by the moharjis * * *
“I live in a sort of hope that the progress southward may be arrested. It surely would not be too much of an irregularity for British ships to go to certain points on the coast for this purpose.”
Achramythium and the villages of the district, where the Christian population was large are now completely emptied of their inhabitants. I suppose the same is now the case as regards Chesme district.”
Aus dem Bericht für das Jahr 1915 der Medizinischen Abteilung zu Urmia (Iran), gerichtet an das Leitungsgremium des Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church in the U.S.A.
(…) One of the most terrible things that came to the notice of the Medical Department was the treatment of Syrian women and girls by the Turks, Kurds and local Mohammedans. After the massacre in the village of …, almost all women and girls were outraged, and two of the little girls, aged eight and ten, died in the hands of Moslem villains. A mother said that not a woman or girl above twelve (and some younger) in the village of … escaped violation. This is the usual report from the villages. (…)
The most diabolically cold-blooded of all massacres was the one committed above the village of Ismael Agha’s Kala, when some sixty Syrians of Gawar were butchered by the Kurds at the instigation of the Turks. These Christians had been used by the Turks to pack telegraph wire from over the border, and while they were in the city of Urmia they were kept in close confinement, without food or drink. On their return, as they reached the valleys between the Urmia and Baradost plains, they were all stabbed to death, as it was supposed, but here again, as in two former massacres, a few wounded, bloody victims succeeded in making their way to our hospital.
(Quelle: Viscount Bryce (Ed.): The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire. 2nd ed. Beirut, 1979, S. 161 f.)
Grigoris Palakian (Krikoris Balakian): Gethsemane-Nacht
Während die Konstantinopler Armenier, noch müde vom Osterfest, in dieser Nacht des 24. April 1915 [11. April alten Stils] ruhig schliefen, herrschte im Polizeipräsidium lautlose, geheime Betriebsamkeit. Blutrote Militärbusse fuhren verhaftete Armenier aus allen Vierteln und Vorstädten der Hauptstadt gruppenweise zum Zentralgefängnis. Schon Wochen zuvor hatte der Polizeipräsident Bedri allen hauptstädtischen Polizeiwachen versiegelte Umschläge geschickt. Diese sollten erst an einem bestimmten Tag auf Befehl geöffnet werden und enthielten Anweisungen, in denen unter höchster Geheimhaltung und mit größter Genauigkeit Folge zu leisten war. Zu den geheimnisvollen Anweisungen gehörte eine im Auftrag des örtlichen Ittihat-Komitees von Artin Mkrttschjan und anderen armenischen Verrätern erstellte Schwarze Liste zu verhaftender Armenier.
Alle, denen eine aktive Rolle im armenischen politischen und gesellschaftlichen Leben zugeschrieben wurde und die das Volk angeblich zu Revolution und Widerstand hätten führen können, waren damit zum Tode verurteilt.
In dieser unglückseligen Samstagnacht brachte man mich mit acht Freunden aus Skutari [türk. Üsküdar] erst zur Selimiye-Kaserne und von dort mit dem Dampfboot nach Sirekci. Es war eine unheimliche Nacht, das Meer toste, und wir sahen unruhig zu, von düsteren Gedanken gepeinigt, einem ungewissen Schicksal entgegen.
Während wir unter strenger Bewachung zum Zentralgefängnis transportiert wurden, durften wir nicht miteinander sprechen. Im Hof dieses von riesigen Festungsmauern umgebenen und mit kolossalen eisernen Toren bewachten Gebäudes wurden wir in einen Holzpavillon, eine ehemalige Schule, gesperrt.
Wir saßen stumm auf dem nackten Fußboden des in fahles Licht getauchten Raumes. Was war, was würde mit uns geschehen? Keiner besaß den Mut, dieses schreckliche Rätsel zu lösen. Eine neue Wendung unterbrach unsere ängstlichen Spekulationen über die Zukunft. Das schwere eiserne Gefängnistor öffnete sich mehrmals und mit gespenstischem Knarren. Gruppen aneinander gepresster Menschen wurden herein geschoben – allesamt bekannte armenische Persönlichkeiten: politische Führer, Gemeindeaktivisten, unpolitische und selbst politikfeindliche Intellektuelle. Bis zum Morgen wurden stündlich neue Gefangene eingeliefert. Hinter den unüberwindlichen Festungsmauern zog tief in der Nacht plötzlich Leben ein – die Zahl der Neuankömmlinge wuchs ständig. Es war, als hätten alle prominenten Armenier der Hauptstadt – Mitglieder der Nationalversammlung, Abgeordnete, Parteimitglieder, Redakteure, Ärzte, Apotheker, Kaufleute, Bankiers – in dieser Nacht in den dunklen Kellern des Zentralgefängnisses eine Verabredung gehabt.
Ein Tag später. Am Sonntag, den 25. April 1915 auf dem Haidar-Pascha-Bahnhof in Konstantinopel:
Nach mehr als zwei Stunden qualvollen Wartens pferchte man uns in einen Zug, der schon bereitstand, um uns nach Kleinasien zu bringen. Dort sollten einige Monate später alle meine Leidensgefährten bis auf wenige Ausnahmen den grausamsten Märtyrertod erleiden.
Aus dem Buch „Zwei Kriegsjahre in Konstantinopel: Skizzen deutsch-jungtürkischer Moral und Politik“ (Lausanne 1917) des deutschen Auslandskorrespondenten Harry Stürmer
Nur eine Episode will ich hier noch erwähnen, die mir von allem, was ich erlebt, persönlich am meisten nahe ging.
An einem Sommertag 1916 gegen Mittag ging meine Frau, um etwas einzukaufen, allein in die ‚Grand Rue de Pera’. Wir wohnten ein paar Schritte vom Galata-Serai und hatten täglich vom Balkon aus genügend Gelegenheit, die Gruppen unglücklicher armenischer Deportierter unter Gendarmerieeskorte die Polizeiwache betreten zu sehen. Man wird schließlich auch gegen solche Anblicke abgestumpft und sieht zuletzt darin kaum mehr das menschliche Einzelschicksal, sondern fast nur noch das Politische. Dieses Mal aber kam nach wenigen Minuten meine junge Frau am ganzen Körper zitternd wieder zurück in die Wohnung. Sie hatte ihren Weg nicht fortsetzen können. Am ‚Karakol’, der Polizeiwache, vorbeigehend, hörte sie aus dem offenen Vestibül die klagenden Töne eines Gefolterten, dumpfes Stöhnen wie von einem halb schon zu Tode gequälten agonisierenden Tiere. ‚Ein Armenier’, gab einer von den am Eingang Stehenden meiner Frau zur Auskunft. Dann wurde die Menge von einem Polizisten weggejagt. ‚Wenn solche Szenen am hellen Mittag am belebtesten Punkt der Europäerstadt Pera vorkommen, dann möchte ich nicht wissen, was man mit den armen Armeniern im unzivilisierten Innern treibt’, frug mich meine Frau.
Schwester Klara Pfeiffer („Deutscher Hilfsbund für christliches Liebeswerk im Orient“) über die Festnahmen armenischer Männer im Frühjahr 1915 in Mesereh:
In jener Zeit hörten wir aus verschiedenen Gegenden von Ausweisungen der armenischen Bevölkerung; doch bei uns war es verhältnismäßig immer noch ruhig, bis am 1. Mai plötzlich einige Männer – die meisten von ihnen gehörten zu der besseren Klasse – verhaftet wurden. (…) Es wurden in verschiedenen Häusern Hausdurchsuchungen gehalten, weil man revolutionären Büchern und Schriften nachspürte. (…) Bald darauf wurde bekannt gemacht, alle Armenier müssten ihre Waffen bis zu einem bestimmten Tage abliefern. (Es waren das Waffen, welche in den meisten Fällen die einzelnen zu ihrem Schutz im Hause hatten oder auch auf Reisen mit sich führten.) Bemerkt sei noch, dass es von Regierungsseiten Erlaubnis gab, Waffen zu tragen. Soviel mir in Erinnerung ist, war es Anfang Juni 1915, dass die Bekanntmachung gegeben wurde. Die Aufregung unter der armenischen Bevölkerung war darüber sehr groß. Jeder, der im Besitz einer Waffe war, wollte sie nicht gern abgeben, weil er das Schlimmste fürchtete. Eine Anzahl wurde abgegeben, aber viele wurden versteckt. So wurden von Seiten der Regierung Zwangsmaßregeln angewandt. Einzelne Männer wurden gefangen gesetzt, gepeinigt und geschlagen. Es wurde von ihnen verlangt, dass sie angeben sollten, wer Waffen hätte und wo diese versteckt seien. An den Folgen dieser Marter starben damals schon einzelne Männer. Ganze Dörfer wurden von Soldaten eingeschlossen, viele von den männlichen Dorfbewohnern angebunden und aufs entsetzlichste geschlagen, weil man nicht glaubte, dass alle Waffen abgegeben seien. Unter solchen Schlägen kamen denn auch noch viele zum Vorschein. Auch einige Bomben wurden herausgegeben. Wo aber auch alles abgegeben war, bekamen die Leute meist doch keine Ruhe. Es wurde erzählt, dass manche von den Armeniern, wenn sie keine Waffen mehr hatten, solche kauften, damit sie von ihren Peinigern, durch Abgabe derselben, freigelassen würden. Was einzelne Personen und auch ganze Dörfer in jener Zeit gelitten haben, lässt sich mit Worten nicht ausdrücken. Wir deutschen Geschwister selbst suchten die Armenier zu ermahnen, doch ja, wenn noch irgend Waffen versteckt seien, dieselben herauszugeben, da wir hofften, dann nähme die Not ein Ende und die Bevölkerung würde am Ort gelassen. Herr Ehmann ist persönlich hin und her in die einzelnen Dörfer gegangen, um die Leute zu ermahnen, nichts zurück zu halten. Er bekam sogar Erlaubnis ins Gefängnis zu gehen, um den einzelnen einzureden, ja alles auszuliefern.
Die ganze Zeit des Waffeneinsammelns wurden ununterbrochen Männer ins Gefängnis gesteckt. Oft wurden sie mitten in der Nacht aus den Betten geholt.
Es war wohl um die Mitte Juni, als es plötzlich morgens hieß: „Vergangene Nacht sind eine ganze Anzahl, ich glaube es waren 600 Mann von den Gefangenen, aus dem Gefängnis abgeführt worden. Wohin? … Gott allein weiß es. Man hörte und sah nichts wieder von ihnen.
Am 23. Juni wurden nachts wieder 300 Mann aus dem Gefängnis abgeführt. Am Morgen des darauf folgenden Tages war Weinen und große Not überall. Die Verwandten, welche bis dahin ihren Angehörigen Essen gebracht hatten, fanden das Gefängnis —- leer.
Wo blieben die Männer? — Es ist nicht anzunehmen, dass noch einer von ihnen lebt. Weil sie aneinandergebunden waren, war ein Entfliehen ausgeschlossen. Und wenn sie geflohen wären – wohin? Das Nachstellen und Aufsuchen nahm eben kein Ende.

Charberd (türk.: Harput), Mai 1915: Unter Bewachung werden die führenden Armenier der Stadt fortgeführt und erschlagen.
Quelle: Maria Jacobsen: Diary (Oragrutjun) 1907-1919, Kharput-Turkey. Antelias 1979
Schwester Alma Johansen („Deutschen Hülfsbund für christlichen Liebeswerk im Orient“) berichtet ebenfalls aus Mesereh:
Anfang Mai 1915 fingen in Mesereh (amtlich Mamuret-ul-Aziz) die Verfolgungen an. Man verhaftete die Männer, klemmt ihnen die Füße in Hölzer und beschlug sie mit Nägeln wie Pferde; Nägel, Barthaare, Augenwimpern, Zähne wurden ihnen ausgezogen, an den Füßen wurden sie aufgehängt usw. Diese sind bei diesen Quälereien gestorben, einzelne, die in die Pflege der Missionare gekommen sind, haben wir gesehen. Damit man das Geschrei der Gepeinigten nicht hören sollte, ließ man rings um das Gefängnis mit Trommeln und Pfeifen spielen. Vielen hat man unter diesen Qualen Geständnisse erpresst über Taten, die sie nie begangen haben.
Aus: Sommer, Ernst: Die Wahrheit über die Leiden des armenischen Volkes in der Türkei während des Weltkrieges. Frankfurt a.M., 1918
Abschiedsbrief des in Berlin ansässigen armenischen Arztes Armenak Hairanjan vom 28. Juni 1915 aus Sivas an Dr. Johannes Lepsius nach Potsdam:
Verehrter Herr Doktor,
Nun bin ich auch verhaftet worden, wie alle Armenier, und warte im Gefängnis mit zwei anderen armenischen Stabsärzten auf die Verbannung. Wir alle leben in tausendmal schlimmeren Verhältnissen als der grausamste Krieg. In den armenischen Provinzen ist kein Armenier mehr geblieben, alle sind deportiert worden. Von unserer großen Familie ist niemand mehr geblieben, auch nicht mein 80jähriger Vater und meine alte, kranke Mutter, derentwegen ich nach der Türkei gereist war. Seit Wochen habe ich keine Nachricht mehr von ihnen. Ich weiß nur, dass jedes Mitglied der Familie separat verschickt worden ist nach verschiedenen fernen Ortschaften. Pass und Telegraph funktionieren nicht mehr für uns. Die Verbannten müssen zu Fuß gehen und tausend Lebensgefahren harren ihrer auf dem Wege.
Seit dem Beginn der allgemeinen Mobilmachung habe ich gewissenhaft der türkischen Armee gedient und als der erste unter den Ärzten Flecktyphus gehabt. Sie können ganz sicher sein, dass wir fern von jedem revolutionären Gedanken geblieben sind. In Wirklichkeit hat es keine revolutionäre Bewegung hier in Sıvas gegeben, von anderen Ortschaften wissen wir gar nichts.
Jeden Moment kann ich verbannt werden wie die anderen und das Schlimmste kann mir auf dem Wege passieren. Im Kriege sterben ist nichts, aber so sinnlos unterzugehen, der Gedanke ist unerträglich. Ich bitte Sie, verehrter Herr Doktor, in diesen schweren Zeiten auch an mich und meine Familie denken zu wollen. Ich habe jetzt alles verloren, Eltern und sechs Brüder und unser ganzes großes Vermögen, mein Leben scheint mir persönlich in all diesem schweren Unglück nicht viel wert zu sein. Aber wie wird es meiner Frau und meinen Kindern in Berlin ohne mich ergehen! Wenn ich sterbe, vertraue ich sie, nächst Gott, Ihnen an. Das wird mein größter Trost sein.
Grüßen Sie bitte Ihre verehrte Frau Gemahlin und Ihre ganze Familie, auch Dr. Rohrbach und Pfarrer Stier und alle unsere Freunde. Ich wünsche Ihnen allen Glück und Gesundheit. In ewiger Dankbarkeit
Ihr
gez. A. Hairanian
Aus dem 1919 veröffentlichten Bericht der armenischen Deportierten Pailadzo Captanian aus Samsun
„Unglücklich die Frauen, die schwanger sind und stillen werden in diesen Tagen!“ Diese Passage aus dem Evangelium traf besonders auf die armen Deportierten zu. Wie viele Frauen kamen auf den Straßen nieder und wie viele verloren ihr Kind! Sie waren völlig ausgeliefert. Gnadenlos peitschten die Gendarmen auf sie ein. Sie durften nicht aufhören zu laufen und starben oft zusammen mit dem Neugeborenen. Eine Frau wand sich noch unter den Schmerzen der Geburt, als ihr ein Gendarm die Sachen raubte. Er hatte ihr nicht gelassen, womit sie ihr vor Kälte zitterndes Kind hätte einwickeln können. Eine andere Deportierte eilte hinzu und bedeckte das Kleine mit einem Kleidungsstück. Fünf Minuten später kam der Befehl zum Aufbruch. Die Niedergekommene musste sich beeilen, um nicht zurückzubleiben. Sie lief und zog eine Blutspur hinter sich her.
Als Krankenpflegerin des Roten Kreuzes wurden Thora von Wedel-Jarlsberg und Eva Elvers im Juni 1915 Zeuginnen der Deportationen in Erzincan. In ihrem schriftlichen Bericht heißt es unter anderem:
Am Abend des 18. gingen wir mit unserem Freunde Herrn Gehlsen, vor unserem Haus auf und ab. Da begegnete uns ein Gendarm, der uns erzählte, dass kaum 10 Minuten oberhalb des Hospitals eine Schar Frauen und Kinder aus der Beiburtgegend übernachtete. Er hatte sie selber treiben helfen und erzählte nun in erschütternder Weise, wie es ihnen auf dem weiten Wege ergangen sei. ‚Schlachtend, schlachtend bringen sie sie daher,‘ ‚Jeden Tag 10-12 Männer getötet und in die Schluchten geworfen, den Kindern, die nicht mitkommen können, die Schädel eingeschlagen, die Frauen bei jedem neuen Dorfe beraubt und geschändet. Ich selber habe drei nackte Frauenleichen begraben lassen, Gott möge es mir zurechnen‘, so schloss er seinen grauenerregenden Bericht. . . Am folgenden Morgen in aller Frühe hörten wir, wie die Todgeweihten vorüberzogen. Wir schlossen uns ihnen an und gingen mit ihnen zur Stadt. Der Jammer war unbeschreiblich. Es waren nur zwei Männer übrig geblieben, von den Frauen waren einig geisteskrank geworden; eine rief: ‚Wir wollen Moslem werden, wir wollen Deutsche werden, was ihr wollt, nur rettet uns, jetzt bringen sie uns nach Kemagh und schneiden uns die Hälse ab. … Als wir uns der Stadt näherten, kamen viele Türken geritten und holten sich Kinder oder junge Mädchen. Am Eingang der Stadt, wo auch die deutschen Ärzte ihr Haus haben, machte die Schar einen Augenblick halt, ehe sie den Weg nach Kemagh einschlug. Hier war es der reine Sklavenmarkt, nur dass es nichts bezahlt wurde. …
Am 21. Juni reisten wir von Erzingjian ab. . . Auf dem Wege begegnete uns ein großer Zug von Ausgewiesenen, die erst kürzlich ihre Dörfer verlassen hatten und noch in gutem Zustande waren. Wir mussten lange halten, um sie vorüber zu lassen, und nie werden wir den Anblick vergessen. Einige wenige Männer, sonst Frauen und eine Menge Kinder, viele davon mit hellem Haar und großen blauen Augen, die uns so todernst und mit solch unbewusster Hoheit anblickten, als wären sie schon Engel des Gerichts. In lautloser Stille zogen sie dahin, die Kleinen und die Großen, bis auf die uralte Frau, die man nur mit Mühe auf dem Esel halten konnte, alle, alle, um zusammengebunden vom hohen Felsen in die Fluten des Euphrat gestürzt zu werden. In jenem Tale des Fluchs Kemagh Boghasy. So machte man es jetzt, erzählte ein griechischer Kutscher, und die Leichen sind ja auch tiefer unten flussabwärts gesehen worden. Das Herz wurde einem zu Eis. Unser Gendarm erzählte, er habe eben einen solchen Zug von 3000 Frauen und Kindern von Mama Chatun, zwei Tage von Erzerum, nach Kemagh gebracht.
Aus dem Erlebnisbericht der schwedischen Missionsschwester Thora von Wedel-Jarlsberg an den deutschen Botschaftsrat Neurath in Konstantinopel vom Juli 1915
(…) Jetzt kamen fortwährend Züge von Ausgewiesenen an aus der Gegend von Erzurum und Baiburt; alle wurden sie nach dem Kunagh Boghasy gebracht und dort von einem hohen Felsen mit gebundenen Händen in den Euphrat gestürzt, um auf diese Weise nach Arabistan gebracht zu werden. Diese Art zu töten hat man wohl später als die billigste und für den Mörder leichteste erkannt. Die Männer, die nicht Soldaten waren, wurden vorher abgeschlachtet. ‚Kesse kesse getiriorlar’ sagte uns ein Gendarm und beschrieb uns, wie die Frauen, die manchmal acht Tage unterwegs sein mussten, ehe sie den Ort der Hinrichtung erreichten, bei jedem Dorf geschändet und geplündert wurden, während den kleinen Kindern der Schädel eingeschlagen wurde, wenn sie das Vorwärtskommen hinderten. Der uns später begleitende Gendarm erzählte uns, er habe einen solchen Zug von dreitausend Frauen und Kindern von Mama Chatun nach Kunagh Boghasy gebracht. ‚Lep gitdi bitdi’. Auf unsere Frage, weshalb sie sie nicht gleich in ihren Dörfern töteten, sondern sie so namenlosen Qualen aussetzten, kam die Antwort: ’So ist es recht, sie müssen elend werden. Und, was sollen wir mit den Leichen machen, sie würden ja stinken.’“
(Quelle: Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Berlin, 28.07.1915)
Aus dem an die Reichstagsabgeordneten gerichteten Appell des Lehrers Dr. Martin Niepage, Aleppo (Oktober 1915):
Gegenüber der deutschen Realschule in Aleppo, in der wir als Lehrer unterrichten, liegt in einem der Chans als Rest solcher Transporte ein Haufe von etwa vierhundert ausgemergelten Gestalten, darunter etwa einhundert Kinder (Knaben und Mädchen) von fünf bis sieben Jahren. Die meisten krank an Typhus und Dysenterie. Tritt man in den Hof, so hat man den Eindruck, in ein Irrenhaus zu kommen. Bringt man ihnen Nahrung, so bemerkt man, dass sie das Essen verlernt haben. Der durch monatelangen Hunger geschwächte Magen vermag keine Speise mehr aufzunehmen. Gibt man ihnen Brot, so legen sie es gleichgültig beiseite. Sie liegen still da und warten auf den Tod.
Wie sollen wir Lehrer da mit unseren Kindern deutsche Märchen oder gar in der Bibel die Geschichte vom barmherzigen Samariter lesen? Wie sollen wir gleichgültige Wörter deklinieren und konjugieren lassen, wenn rings in den Nachbarhöfen der deutschen Realschule die verhungernden Volksgenossen unserer armenischen Schüler langsam dem Tode verfallen? Da schlägt doch unsere Schularbeit aller wahren Sittlichkeit ins Gesicht und wird zu einer Verhöhnung menschlichen Empfindens.
Jerwand Otjan: Unter den Zelten von Sebil
Zu den Schrecken der Deportationszeit, die mir immer unvergesslich bleiben werden, gehört der Kinderverkauf in Sebil. Sebil – welches Entsetzen löst dieses Wort in den Seelen der armen Deportierten aus.
Sebil – ein weiträumiges Gelände vor den Toren Aleppos, diente als Durchgangslager für die Deportierten, die Aleppo erreicht hatten und nach Der-es-Sor weitergeschickt werden sollten.
Als ich im Dezember 1915 dort ankam, fand ich ein mit Zelten übersätes Feld vor, in denen Deportierte aus Harput, Malatia, Dikranakert, Bardizag, Ada-Bazar, Brusa, Alexandropolis, Rodosto, Adana, Aintab, Kilis, Konia und Engüri hausten. Die meisten besaßen buchstäblich nichts mehr, oft nicht einmal Kleidung, um ihre Blöße zu bedecken. Kurden, Araber und türkische Feldgendarmen hatten sie vollständig ausgeplündert.
Typhus, Ruhr und Fieber rafften täglich fünf bis sechshundert Menschen dahin. Dungwagen sammelten von morgens bis abends Tote ein. Auf jedem Wagen stapelte man zehn bis zwölf Leichen. Es kam auch vor, dass Sterbende zusammen mit den Toten auf die Wagen geworfen wurden – mit dem Einverständnis ihrer Angehörigen: ‚Jetzt ist keine Zeit auf solche ‚Feinheiten’ zu achten, in ein paar Stunden stirbt er sowieso. Der Wagen ist gerade da, man muss die Gelegenheit nutzen.’

Verhungernder Junge.
Weil Kleidung und Unterwäsche gebraucht wurden, zog man die Toten aus und warf sie nackt auf die Wagen. Diese Dinge spielten sich täglich, in völliger Gleichgültigkeit, vor aller Augen ab.
Doch das Furchtbarste war der Kinderverkauf. Die Käufer, meist arabische oder jüdische Frauen aus Aleppo, stiegen von ihren Wagen, gingen in die Zelte und fragten: ‚Gibt es Kinder zu verkaufen?’
Mütter, die auch nur noch ein Stück Brot hatten, lehnten dieses Ansinnen entsetzt ab. Andere, hungrige, gaben ihr Kind unter Weinen und Jammern für ein paar Münzen her. Die Käufer brachten eine Apfelsine und einen Kringel mit. Sie drückten dem kleinen Mädchen die Apfelsine in die Hand, und die hungrige Kleine begann sofort an der Schale zu knabbern. Den Kringel aber zeigten sie ihr nur und sagten: ‚Den isst du im Wagen.’ Wie ein Lämmchen hinter eine Handvoll Gras herläuft, lief das Mädchen den Frauen und vor allem dem Gebäck nach. Von Zeit zu Zeit schaute es sich weinend nach seiner Mutter um. Oft rannte die Mutter nach dem Verkauf ihres Kindes wie besessen hinter dem Wagen her, riss ihr Kind herunter und warf den Käufern das Geld ins Gesicht. Noch öfter aber sah sie dem davonfahrenden Wagen ohnmächtig nach und wand sich dabei vor Schmerz, gerade so, als rollten die Wagenräder über ihr Mutterherz.
Ich sah, wie eine Mutter kurz nach dem Verkauf ihrer beiden Kinder dem Wahnsinn verfiel.
Wer die Deportationszeit erlebt hat, der kann mit Jeremia sagen: „Ich bin ein Mensch, der Qualen sah.“

Seuchen- und Hungertod 1915/6: das Schicksal der Deportierten
Aus dem Bericht einer armenischen Überlebenden über das Ende in der syrischen Wüste
Ich war zwölf Jahre alt. Ich war mit meiner Mutter zusammen. Sie trieben uns mit Peitschen, und wir hatten kein Wasser. Es war sehr heiß und viele von uns starben, weil es kein Wasser gab. Sie trieben uns mit Peitschen, ich weiß nicht, wie viele Tage, Nächte und Wochen. Schließlich kamen wir bis zur arabischen Wüste. Meine Schwestern und das kleine Baby starben unterwegs. Wir kamen zu einer Stadt. Ich kenne ihren Namen nicht. Die Straßen waren voll mit Toten, alle in Stücke gehauen. Sie trieben uns über sie hinweg. Ich habe Alpträume davon behalten. Wir kamen an einen Platz in der Wüste, einer Senke im Sand, mit Hügeln drum herum.
Da waren Tausende schon da, viele, viele Tausende, alles Frauen und kleine Mädchen. Sie trieben uns wie Schafe in der Senke zusammen. Dann war es dunkel und wir hörten das Schießen um uns herum. Wir sagten: ‚Das Töten hat angefangen.’ Die ganze Nacht warteten wir auf sie, meine Mutter und ich. Wir warteten, dass sie uns erreichten. Aber sie kamen nicht, und am Morgen, als wir umher guckten, war niemand getötet worden. Sie hatten gar nicht damit begonnen, uns zu töten. Sie hatten den wilden Stämmen Signale gegeben, dass wir da waren. Die Kurden kamen später am Morgen, im Morgengrauen, die Kurden und viele andere Männer aus der Wüste. Die kamen über die Hügel und ritten hinunter und begannen, uns zu töten. Den ganzen Tag über waren sie am Morden. Sie müssen sich vorstellen, da waren so viele von uns. Sie töteten alle, von denen sie meinten, dass sie diese nicht verkaufen könnten. Das Töten dauerte auch noch die ganze Nacht über an und am Morgen – am Morgen töteten sie meine Mutter.
Aus: Elliott, Mabel E.: Beginning again at Ararat. Zitiert nach: Berlin, Jörg; Klenner, Adrian: Völkermord oder Umsiedlung? Das Schicksal der Armenier im Osmanischen Reich; Darstellung und Dokumente. Köln, 2006, S. 25 f.

Armenische Deportierte mit ihren Kindern.
Quelle: The Armenian Genocide.
Los Angeles, 1987
Die meisten Deportierten erreichten nicht die mesopotamische Wüste, von Innenminister Talat zynisch als „Ort ihrer Verbannung“ bezeichnet. Schwester Paula Schäfer („Deutscher Hilfsbünd für christliches Liebeswerk im Orient“) berichtete im Dezember 1915 aus Kilikien:
Meine letzte Reise, die fast 7 Wochen dauerte, war einfach unbeschreiblich. Wir ritten von Marasch gegen vier Uhr ab – kamen abends gegen acht Uhr bei Dunkelheit nahe Dereköye – wir wollten die Nacht durchreisen, doch die Pferde gingen so unruhig in der Dunkelheit, infolge der vielen herumliegenden Leichen, dass wir unbedingt in ein Feld einbiegen mussten, da es uns selbst schauderte, über all die Gerippe, den entsetzlichen Gestand der Leichen. Kein Mensch weit und breit, nur Leichen sah man – aber mitten im Wege – so dass die Pferde einen großen Bogen machten, wenn sie daran vorbeikamen! – Kleine, vier Wochen alte Babys fanden wir nackt am Straßenrand – noch lebend! Auch unter den Sträuchern lagen sie und schrien vor Hunger und Durst. Am Morgen sahen wir übel zugerichtete Männer- und Frauenleichen, die alle nur so dahingeschlachtet waren – zerhackte Arme und Beine – so lagen sie da in ihrer Blutlache. – Einer Frau, die hochschwanger war, hatten sie einen dünnen Baum durch die Genitalien gestoßen bis die Spitze an der rechten Seite, der Nierengegend – herauskam. – Teilweise lagen die Leute respektive die Leichen verkohlt da – Kinder saßen oft drei bis vier auf den Feldern, bis die Kurden oder Türken kamen und sie mitnahmen. Wir sammelten acht solcher Kinder auf und brachten sie nach Marasch. Die ganze Strecke von Marasch bis Baghtsche war eine Leidens- und Sterbensstraße – es war schrecklich. – Männer mit Bajonettstichen in Brust und Leib lagen am Wege und verbluteten sich! Ich bot ihnen an, auf mein Tier zu steigen, um sie nach Baghtsche ins Hospital zu nehmen, aber sie flehten mich an, ihnen Brot und Wasser zu geben und sie an ihrem Ort sterben zu lassen. Können Sie sich denken, wie es mir zumute war, so diese dem Tod Geweihten sich überlassen zu müssen und weiter zu ziehen?
Aus: Sommer, Ernst: Die Wahrheit über die Leiden des armenischen Volkes in der Türkei während des Weltkrieges. Frankfurt a.M., 1918
Aus dem Bericht der armenischen Überlebenden Yuraber (Yüghaper) Tirasjan (Dirazuian) aus Sejtun, aufgezeichnet am 14. Mai 1989 in Paris:
Man brachte uns nach Scheddade, an eine Höhle. Ihre Öffnung war so groß wie ein Tisch, aber unten hatte sie das Ausmaß von zwei oder drei Zimmern. Man ergriff die Frauen wie Säcke, zündete ihre Rocksäume an und warf sie hinunter. Alles schrie. Als ich dran war, bin ich schnell selbst gesprungen. Ich blutete, kroch zitternd in einen Winkel, verlor das Bewusstsein… Am nächsten Tag kamen Männer in die Höhle, es waren keine Türken mehr, sondern Araber. Sie suchten nach Goldmünzen. Ich bekam mit, wie man einer Frau, die zugab, ihr Geld verschluckt zu haben, den Bauch aufschlitzte. Mich zerrten sie von einer Ecke zur anderen und brüllten: ‚Ausziehen, ausziehen!’ Als ich immer wieder beteuerte, dass ich nicht hätte, nicht einmal zu essen und zu trinken, bekam einer von ihnen Mitleid. Sein Cousin, der ihn mit einem Seil heruntergelassen hatte, zog mich herauf. Draußen lagen Frauen und Kinder mit aufgeschlitzten Bäuchen. Die beiden jungen Araber taten so, als ob ich zu ihnen gehörte, damit die in der Nähe stehenden türkischen Gendarmen nichts merkten. Als sie mich zu sich nach Hause brachten, hat mich die Mutter des einen weinend umarmt und geküsst… Ich war die einzige Überlebende aus der Höhle.

Syro-Aramäer aus der Stadt Midyat in traditioneller Tracht.
Quelle: Lehmann-Haupt, C.F.: Armenien einst und jetzt. Berlin-Leipzig 1910, Bd. 1
Bericht über das Martyrium der Einwohner des syro-aramäischen Dorfes Chazna
Als die türkischen Soldaten ins Dorf kamen, gingen sie zu Ibrahim Chalil, um die Syro-Aramäer des Dorfes umzubringen. Die Syro-Aramäer wurden beim Dorfherrn gesammelt. Dann bestellte Ibrahim den Chalil Isa und drei weitere zu sich, als ob er ihnen ein Geheimnis anvertrauen wollte. Sogleich überfielen die türkischen Soldaten die Herbeigerufenen, nahmen sie fest, fesselten sie und danach die übrigen. Sie sammelten auch die Frauen und Kinder und führten sie aus dem Dorf, um sie umzubringen. Die Braut von Isa, die Chazme hieß, war eine sehr hübsche Frau. Die Gottlosen sagten zu ihr: „Bekenne dich zum Islam und wir verschonen dich!“ Sie aber erwiderte: „Muslimin will ich nicht werden. Ich verabscheue euch und eure Religion! Für meinen Herrn Christus bin ich bereit, den Tod zu erleiden, Leid und Nöte zu ertragen.“ Sie musste schwere Qualen erdulden, während sie die ganze Zeit die Hand ihres Mannes festhielt, und er ließ sie nicht los, bis sie ihren Geist aushauchte. So ermordeten sie alle und keiner von ihnen blieb verschont.
Bericht über das Ende der syro-aramäischen Bevölkerung von Kafro
Als die syro-aramäischen Einwohner von Kafro die Nachricht über das Massaker an den Christen vernahmen, suchten sie Zuflucht in der Mor Jaqub-Kirche. Dann kamen die Kurden mit Josef Ağa, dem Sohn des Hassan Schamdin und Herrscher von Kfargusson, umstellten die Kirche und griffen die Syro-Aramäer an. Der Kampf dauerte fünf Tage, denn die Syro-Aramäer hatten sich nicht auf den Kampf vorbereitet, weswegen sie auch nicht genügend Waffen besaßen. Wasser fehlte ebenfalls, außer einem Brunnen, zu dem sie durch einen unterirdischen Gang gelangen konnten. Als die Feinde davon erfuhren, warfen sie Holz und Docht in den Brunnen und setzten es in Brand, so dass die Syro-Aramäer kein Wasser mehr schöpfen konnten und dursten mussten.
Da trat Josef Ağa vor die Tür der Kirche und schwor ihnen, dass er sie nicht töten werde. Sie sollten aus der Kirche kommen, weil sie alle sonst verhungern und verdursten würden. Die Syrer vertrauten seinen Worten, denn sie konnten ohnehin nicht mehr kämpfen. Blieben sie in der Kirche, würden sie verhungern und verdursten. So öffneten sie die Tür. Zuerst fesselten die Kurden die Priester, dann die Oberhäupter des Dorfes sowie einen ehrbaren Mönch namens Odom aus Kafro, führten sie aus dem Dorf, drangsalierten sie und fügten ihnen viel Leid zu und setzten sie schweren Martern aus, danach massakrierten sie alle. Dem Mönch stachen sie bei lebendigem Leibe die Augen mit einer glühenden Stange aus. Anschließend führten sie die übrigen Bewohner aus dem Dorf und erstachen sie alle. Etliche Frauen warfen sie in den Brunnen, die Kinder aber brachten sie nicht um, sondern sie machten sie zu ihren Sklaven, Dienern und Hirten, bis sie erwachsen waren. Die Kinder traten nicht zum Islam über, sondern blieben Christen.
Kindermord in Midyat
Mein Onkel Musa war im „Jahr des Schwerts“ [Sayfo] sechs Jahre alt. Als Junge hörte ich seine Geschichte über den Sayfo.
Auf dem Markt von Midyat gab es einen Ort, der Schafqo hieß, nahe dem Haus der [protestantischen] Nateqo-Familie. Und dort beobachtete ich, wie türkische Soldaten kleine christliche Jungen töteten. Sie warfen die Jungen [vom Dach] herunter von dem hohen Gebäude, damit sie sofort stürben. Viele christliche Deportationskonvois kamen in Midyat an, und sie bestanden aus Frauen und Kindern. Diese wurden in den Innenhof der Moschee gebracht, der bald überfüllt war. Um die Zahl der Geiseln zu senken, sammelten die türkischen Streitkräfte die Jungen, etwa 500-600 an der Zahl. Sie befahlen ihnen, sich mit dem Gesicht nach unten hinzulegen. Danach nahmen sie einige dicke Stöcke und schlugen ihnen auf die Köpfe. Danach ritten 40 bis 50 türkische Soldaten zu Pferd über die Köpfe der Jungen hin und her, bis sie tot waren.
Bericht des Chaldäers Habib Maqsi-Musa, geb. 1948, interviewed im August 2003; entnommen: Gaunt, David: Massacres, Resistance, Protectors; Muslim-Christian Relations in Eastern Anatolia during World War I, 2006, S. 342
Aus den Erinnerungen des armenischen Deportierten Warteres Mikail Garugjan
As we walked along the yol (path), we encountered decaying corpses of men and women. The stench was terrible. I asked my guards who these dead bodies were and where they came from. They informed me, truthfully, that these bodies were Greek emigrants who had been deported from the edge of the Black Sea. Because they were unable to survive the travel and hunger, they became ill and died. Since the moving caravans did not have time to bury the dead bodies, they left them on the path and departed. (…) As we continued on our journey, we encountered more corpses, large and small, being devoured by ravenous vultures. These people who became food for the birds had descended from the ancient, mighty Greek and Roman empires which at one time reigned over an extensive area from this region up to the faraway Armenian principalities of Kars. How much can change through the ages! The descendants of yesterday’s rulers have now become slaves, dying of hunger, driven along these same paths.
Wie wir den Pfad (yol) entlanggingen, trafen wir auf die verwesenden Leichen von Männern und Frauen. Der Gestank war schrecklich. Ich fragte meine Bewacher, wer diese Toten waren und woher sie stammten. Ich fragte meine Bewacher, wer diese Toten waren und woher sie stammten. Sie teilten mir wahrheitsgemäß mit, dass diese Körper griechische Emigranten waren, die vom Rande des Schwarzen Meeres deportiert worden waren. Weil sie nicht imstande waren, die Strapazen der Reise und den Hunger zu überleben, erkrankten sie und starben. Da die wandernden Deportiertenkonvois keine Zeit fanden, um die Toten zu begraben, ließen sie sie auf dem Weg zurück und zogen weiter (…). Als wir unsere Reise fortsetzten, stießen wir auf weitere Leichen, große und kleine, die von Geiern gefressen wurden. Diese Menschen, die jetzt zur Nahrung für die Vögel geworden waren, stammten von den alten, mächtigen griechischen und römischen Reichen ab, die einst über ein großes Gebiet von jener Region bis zu den fernen armenischen Fürstentümern von Kars geherrscht hatten. Wie viel kann sich im Laufe der Jahrhunderte ändern! Die Nachkommen der gestrigen Herrscher sind inzwischen zu Sklaven geworden, die Hungers sterben und dieselben Wege wie wir entlang getrieben wurden.
Garougian, Varteres Mikail (Destiny of the Dzidzernag Princeton/London: Gomidas Institute 2005), S. 142-3
Der griechisch-orthodoxe Erzbischof von Amaseia (Amasya) and Samsun, Germanos, über die Deportierten im Pontosgebiet, 1916
First, the army reduced to ashes the entire surrounding region. Nearly all the villages (…) were pillaged and then set on fire. A large number of women and children were killed, the young girls outraged and immediately afterward driven into the interior. Where? Into the vilayet of Angora, to Tchoroum, to Soungourlou, and still further. The winter was of the most severe kind; these girls had to march thirty or forty days across snow covered mountains and sleep by night in the open. For several days they were without food, for they were not even allowed to use money to buy bread; they were continually beaten by the gendarmes and stripped of any money they might have on them, and when they got to the towns they were brutally pushed into the hot public baths, on the pretext of hygiene and cleanliness, and just as quickly dragged out. Thus, an easy prey to the rigors of the cold, they were driven on further. The majority, of course, died on the road, and none of the dead being buried at all, vultures and hogs feasted on human flesh.” Zunächst legte die Armee die gesamte Region in Schutt und Asche. Fast alle Dörfer (…) wurden geplündert und dann in Brand gesetzt. Eine große Zahl an Frauen und Kinder wurde getötet, die jungen Mädchen geschändet und unmittelbar danach in das Landeinnere getrieben. Wohin? In die Provinz Angora [Ankara], nach Tschorum, Sungurlu und noch weiter. Der Winter war äußerst streng; diese Mädchen mussten 30 oder 40 Tage durch schneebedeckte Bergen laufen und nachts unter freiem Himmel schlafen. Mehrere Tage blieben sie ohne Nahrung, denn sie durften nicht einmal Brot für eigenes Geld kaufen. Sie wurden fortgesetzt von den Gendarmen geschlagen und ihres gesamten Geldes beraubt, und wenn sie in eine Stadt kamen, wurden sie unter dem Vorwand der Hygiene und Sauberkeit brutal in die öffentlichen Dampfbäder gestoßen und ebenso schnell wieder herausgezogen. Auf diese Weise eine leichte Beute für die Anstrengungen der Kälte, wurden sie weiter getrieben Natürlich starben die meisten auf der Straße, und keine der Toten wurden beerdigt. Geier und Wildhunde hielten ihr Festmahl am Menschenfleisch.
Aus dem Kriegstagebuch des deutschen Feldarztes Theo Malade: Islahiye (April 1916) – armenische Zwangsarbeiter
Islahije ist ein sehr großes Lager, weil von hier aus die ununterbrochene Bahnverbindung nach Palästina besteht. (…) Man ist sehr tätig an der Trace nach dem Amanus zu unter Leitung von tüchtigen deutschen Ingenieuren aus den württembergischen Templerkolonien in Palästina. E i n e n gewaltigen Vorteil wird die Türkei aus dem Kriege in die Zukunft nehmen, den niemand ihr rauben kann: Das ganze Land ist von Norden nach Süden mit Bahn und Chausseen ausgebaut worden. Freilich – mit was für Arbeit seitens der Deutschen, mit was für Opfern der einheimischen armenischen Bevölkerung! Zu tausenden, sagt mir der eine Württemberger, haben die Leichen der zu Tode gehetzten, verhungerten, an Seuchen und Strapazen und Hunger gestorbenen Armenier am Wege gelegen, zehntausende sind andernwärts zugrunde gegangen. Ich wollte eines der entvölkerten Armenierdörfer oben in den Bergen sehen. Der Ingenieur lieh mir seinen kleinen anatolischen Gaul. Es war grauenhaft, diese Leere und Totenstille in den elenden Häusern, und man kann sich des tiefen Mitleids nicht erwehren, so unsympathisch der Volksstamm auf den ersten Blick ist mit dem verschlagenen Gesichtsausdruck, den rachitischen Knochen und aufgetriebenen Bäuchen. Aber sein Geschick ist schrecklich. Was noch lebt, muss jeden Tag erwarten, in die Wüste getrieben zu werden zu werden. Die Mädchen werden für ein paar Papierpfunde verkauft und sind glücklich, ein Unterkommen dabei zu finden. Der türkische Etappen-Major hatte zwei derartige halbeuropäisch-geschmacklos behängte Halbkinder bei sich, die nach Tisch sangen und tanzten und sonstigem Vergnügen dienten. Wenn man ihrer satt ist, stößt man sie einfach hinaus. Ich sah ein etwa zwölfjähriges hochschwangeres Mädchen am Straßenrand betteln.
Aus: Theo Malade: Von Amiens bis Aleppo: Ein Beitrag zur Seelenkunde des Großen Krieges; aus dem Tagebuch eines Feldarztes. München: I.F. Lehmanns Verlag, 1930, S. 135-136
Transport armenischer Kinder nach Mardin, Anfang Juli 1917:
Zwei von den Lastautos, die auch mich von Diarbekir zurückbeförderten, transportierten unter der Leitung eines Jusbaschi, eines Hauptmanns, fünfzig ausgemergelte armenische Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren. Dort werden sie weitergegeben – irgendwohin, wo sie an Schlägen, Hitze, Hunger zugrunde gehen. Die Kinder haben, früh vier Uhr, bei der Abfahrt nur einen Schluck Milch erhalten. Sie sitzen zusammengedrängt und kauernd auf dem Boden des Wagens. Sobald sich eines erheben will, tippt der Basch-Tschausch, der Feldwebel, mehr oder weniger zart mit einem Stock auf den Kopf. Ich nehme ihm den Stock ab und verprügele ihn damit. Wir halten nach einigen Stunden an einem Quellwässerchen. Die durchgerüttelten, durchgeglühten Kinder sind fingerdick mit Staub bedeckt und jammern und bitten: Wasser! Der Jusbaschi befiehlt Ruhe. Unsere Soldaten beißen die Zähle zusammen vor Wut. Ich nenne ihn „Vieh“. Ich befehle als Arzt, dass die Kinder sofort absteigen und getränkt werden. Ich drohe, die Autos nicht weiter fahren zu lassen. Unsere Leute nicken mir zu. Als die Kinder herabgehoben sind und wie Hündchen mit den Zungen das Wasser aufschlecken, geht Schwester Käthe, die türkisch spricht, zum Hauptmann. Sie spricht gar nicht erregt wie ich, sondern hausmütterlich belehrend:
Schwester: Warum befiehlst du, dass die Kinder nichts zu trinken kriegen? Siehst du nicht, wie sie dürsten, wie die Ärmchen der Verschmachtenden, die dort auf dem Bodes des Autors liegen, zwischen den Brettern heraushängen?
Jusbaschi: Sie kriegen in Mardin zu essen und zu trinken.
Schwester: Das ist am Abend, nachdem sie hungrig heute Morgen abgefahren sind. Hungerst und dürstest du denn auch? (Auf seine Feldflasche und Brotbeutel zeigend).
Jusbaschi: Das geht dich nichts an. Die Behörde, der Wali hat mir nichts für die Kinder zu essen gegeben. Ich tue das meinige. Da sieh mal (hebt drei Kinder in die Höhe), denen habe ich von mir zu essen gegeben. Wie sie lachen! (Die anderen Kinder strecken die Händchen aus und bitten: Ekmek, Ekmek – Brot, Brot!)
Schwester: Wie viel hast du denn von den Verwandten für die drei Kinder erhalten? Hör mal! Ihr Türken seid wie die Tiere. Wie könnt ihr verlangen, dass man euch achtet? Aber warte, ich will das nach Cospoli melden.
Jusbaschi (plötzlich windelweich): Ah, du fährst doch nicht etwa nach Cospoli?
Schwester: Nein, aber ich habe Beziehungen. Und ich werde dafür sorgen, dass das dort bekannt wird.
Jusbaschi (völlig verändert): Ja, das sollst du tun. Sie müssen oben die Wahrheit erfahren. An allem sind unsere Vorgesetzten schuld. Die sorgen bloß für sich, geben nicht einmal den Soldaten, was ihnen zukommt, viel weniger diesen armen Würmern.
Folgt eine wilde Anklage gegen das „System“. Türkische Offiziere und Soldaten, die auf Kisten und Tanks sitzen, stimmen ein. Auf der Weiterfahrt kommen dauern türkische Soldaten, auch der Basch-Tschausch, und danken uns: Das wäre recht, dass wir einmal die Wahrheit gesagt hätten. Sie müssten ja gehorchen und könnten nichts tun. Unsere Leute wurden ganz vergnügt. Mein Fahrer erzählte mir, zähneknirschend, er habe im Winter öfters solche „Leichenfahrten“ von Kindern machen müssen. Ich fuhr die letzten zehn Kilometer im Personenauto voraus und habe nichts mehr von den Kindern gehört. Ich beobachtete bloß noch: Als in der Ferne Mardin mit der zerrissenen Burg und den Felsmauern auftauchte, hörte das stille Weinen auf – dies furchtbare, stumme Kinderweinen. Alle erhoben sich und hielten sich trotz der wüsten Stöße am Kastenrand fest und stierten mit einem eigenartigen Ausdruck von Erwartung und Entsetzen auf die Stätte, die sie aufnehmen sollte. Ich habe so etwas früher gesehen bei Rindern, die zum Schlachthof getrieben wurden und das Blut rochen.
Aus: Theo Malade: Von Amiens bis Aleppo: Ein Beitrag zur Seelenkunde des Großen Krieges; aus dem Tagebuch eines Feldarztes. München: I.F. Lehmanns Verlag, 1930, S. 205-207
Der in Urfa für die Deutsche Orientmission tätige Deutsch-Schweizer Jakob Künzler über das Schicksal armenischer Zwangsarbeiter (Juni 1916)

Armenische Zwangsarbeiter beim Straßenbau.
Quelle: Maria Jacobsen: Diary (Oragrutjun) 1907-1919, Kharput-Turkey. Antelias 1979
Es war kein leichtes Stück Arbeit für jene Jungtürken, die die Deportierung und die planmäßige Ausrottung der Armenier beschlossen hatten, ein Millionenvolk zu vernichten. Die Deportationen dauerten ein volles Jahr. Die letzten Deportierten kamen im Juni 1916 durch Urfa. Das Merkwürdigste bei diesem Zuge war, dass er sich, gänzlich abweichend von den anderen, hauptsächlich aus jungen Männern rekrutierte. Wie kam das? Die Ingenieure der Bagdadbahn arbeiteten während des Krieges in beschleunigtem Tempo am Bau der Linie. War sie doch geradezu eine Lebensfrage für die Türken und ihre Verbündeten. Nun kann man aber in der Türkei eine Bahn ebenso wenig ohne die Armenier bauen, als in Europa ohne die Italiener. Die Armenier sind das arbeitende Element, das jedes größere Werk zu leisten vermag. Auch an solchen Posten, wo man beim Bahnbau einen Vertrauensmann brauchte, waren es fast ausschließlich Armenier, die ihn ausfüllten. (…) Als nun im Sommer 1915 auch diese fleißigen Arbeiter deportiert werden sollten, haben sich die Bahningenieure, Deutsche und Schweizer, mit aller Macht dagegen gewehrt. Mir erzählte eine dieser Herren, dass sie beinahe ein ganzes Jahr gegen den türkischen Plan, auch diese Arbeiter zu beseitigen, kämpfen mussten. Schließlich mussten sie im Juni 1916 doch einige tausend Arbeiter entlassen. Es waren die Armenier, welche zuletzt durch Urfa zogen. Sie hatten nicht mehr weit zu ziehen. In Veranschehir erreichte sie das gleiche Los, das zuvor Hunderttausende ihrer Brüder ereilt hatte. Mit dem Messer wurden sie alle erledigt.

Getötete Zwangsarbeiter
Thea Halo: Not Even My Name (2000)
In ihrem Buch schildert die Autorin das Schicksal ihrer pontosgriechischen Mutter Themia. Diese wurde mit ihren jüngeren Geschwistern und ihren Eltern im Frühjahr 1920 aus dem Gebirgsdorf Fatsa auf Befehl Mustafa Kemals nach Süden deportiert. Die in der Ich-Form erzählten Erfahrungen der Mutter enthalten unter anderem die Schilderung vom Tod eines Kindes:
„War es an jenem Tag, als die kleine Maria starb? Ich erinnere mich nicht mehr. Ich erinnere mich nur noch an ihren kleinen Körper, der auf Kristodulas Rücken gebunden war, an ihren kleinen, vor- und rückwärtsschaukelnden Kopf, und die Erkenntnis, dass etwas nicht stimmte, stieg in meinem erhitzten Körper auf wie eine kalte, feuchte Panik.
„Mama“, sagte ich so gefasst wie möglich, in der Hoffnung, dass meine Ruhe alles Übrige in Ordnung kommen lassen würde. „Maria sieht komisch aus.“
Mutter blickte hoch und brach in Tränen aus. Marias Gesicht war aschfahl geworden. Wie kleine Puppenaugen starrten ihre Augen ins Leere, gebrochen in einer offenen Stellung, und ihr Köpfchen rollte bei jedem Schritt hin und her.
„Was ist los?“ fragte Kristodula entsetzt. „Was ist denn?“
Wir hielten auf der Straße ein wie ein Haufen Steine in einem Fluss: Die entkräfteten Deportierten umgingen uns und setzten ihren Marsch fort. Mutter nahm Maria von Kristodulas Rücken und wiegte sie in ihren Armen, während ihre Tränen Marias lebloses Gesicht wuschen.
„Vorwärts!“ schrie ein Soldat, als er zu uns getrabt kam.
„Mein Baby“, sagte Mutter.
Sie streckte Maria aus, damit der Soldat sie sehen konnte, als ob ihr Schock und Schmerz auch der seine sein könnten.
„Mein Baby.“
„Wirf es weg, wenn es tot ist!“ schrie er. „Vorwärts!“
„Lass es mich begraben“, flehte Mutter schluchzend.
„Wirf es weg!“ Er schrie erneut und hob seine Peitsche. „Wirf es weg!“
Mutter drückte Marias Körper an ihre Brust, während wir dastanden und ihn anstarrten. Ihr Gesicht war von einer Qual erfasst, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Vater griff nach Maria, um sie, wie ich vermute, niederzulegen, aber Mutter presste sie noch fester an sich. Dann ging sie zu der hohen Steinmauer, die die Straße von der Stadt abtrennte, und hob Maria empor, um sie auf der Mauerkrone niederzulegen wie auf einem Altar vor dem Allmächtigen.
In jener Nacht weinte Mutter sich in den Schlaf. Und immer, wenn ich selbst meine Augen schloss, sah ich sie, wie sie dem Himmel Maria wie ein Opfer darbot. Das Bild von ihrem leblosen Körper, der auf der Mauer lag wie eine Gabe in einem heidnischen Ritual, verfolgte mich sogar bis in meine Träume und alle folgenden Tage hindurch. Jedes Mal, wenn ich an meine kleine Schwester dachte, wie sie da in der brennenden Sonne lag, während die Bussarde kreisten und darauf warteten, dass wir weiterzogen, kam das Schluchzen, ohne dass ich meine Gefühle beherrschen konnte.
Abschiedsbrief des Pontosgriechen Alexandros Akritidis aus Lykast im Bezirk Kromni, Industrieller und Bürgermeister aus der Stadt Trapesunta. Er schrieb einen Tag vor seiner Hinrichtung an seine Ehefrau:
Meine liebe Frau Klió! Heute haben wir die Messe besucht und das Heilige Abendmahl empfangen, wir alle, 150 Personen. Jeden Tag werden an die sechzig Menschen enthauptet. Morgen bin ich an der Reihe… Wie oft habe ich heute geweint! Aber wem nutzt es? Wenn Du von meinem Tod erfährst, sollte für Dich die Welt nicht untergehen. So hat das Schicksal es eben gefügt. Die Kinder sollen spielen und tanzen. (…) Mögen mir alle verzeihen: die Brüder, die Schwägerinnen und alle Verwandten und Freunde! Hoffen wir, dass Gott uns die Gelegenheit gibt, unsere Totenkränze in Ehren zu halten. Lebt wohl denn! Ich gehe zu meinem Vater. Vergebt mir.
Aus: Fotiadis, Konstantinos: Der Völkermord an den Griechen aus Pontos. Bd. 2. Thessaloniki, 2004. Übersetzt aus dem Griechischen: Lampros Savvidis
Nikolaos Tsaikopulos: Mein Dorf Fulaziki (Nicomedien), Kleinasien
Cemil Bey und seine Männer kamen am 21. Juni 1920 in unser Dorf. Er befahl, sämtliche griechischen Männer ab 15 Jahren in der Dorfkirche zu versammeln, wo er, so nahm man an, eine Rede halten wolle. Die Kirche war rammelvoll. Die Türken versperrten die Türen, gossen Petroleum rund um das Gebäude und steckten es an. Die Männer im Inneren brachen die Türen auf und stürzten nach draußen. Von den umliegenden Hügeln eröffneten die Türken das Feuer auf sie. Manche sagen, dass dreihundert getötet wurden, aber ich konnte nur die Namen von 116 Opfern ausfindig machen.
Einer der aus der Kirche entkommenen Männer war der Dorfpriester, Vater Philippos. Die Türken fingen ihn, sattelten ihn mit einem Eselssattel und zäumten ihn auf. Dann setzten sie sich auf ihn, peitschten ihn und zogen derart heftig an seinem Haupthaar und Bart, dass sie ganze Fleischstücke aus seinem Gesicht und Kopf rissen. Sie setzten diese Tortur fort, bis er starb…
Ich hatte mich zusammen mit den anderen Männern und Jungen in einem Keller versteckt. Aber die çeteler entdeckten uns. Sie brachten uns zu einer Lichtung und begannen auf uns zu schießen und mit Bajonetten auf uns einzustechen… Ich gab nicht auf, sondern begann fortzulaufen. Sie schossen von hinten auf mich. Drei Kugeln brachen die Knochen in meinem rechten Arm… Ich verlor so viel Blut, dass ich ohnmächtig wurde und für Tage bewusstlos lag; meine Wunden waren voller Maden. Durch Zufall wurde ich von einigen griechischen Soldaten gefunden, die mich in das Krankenhaus von Konstantinopel brachten, wo man mir den rechten Arm amputierte… Ich war zwölf Jahre alt zu jener Zeit…
Viele meine Dorfgenossen flüchteten in die umliegenden Wälder… Da sie fürchteten, dass die Säuglinge ihren Aufenthalt verraten könnten… haben sie sie getötet.
Christos Kalanzis: Funtuklia
Von unseren 500 Gehöften in Funtuklia steht keines mehr, und von 2500 Christen überlebte weniger als die Hälfte.
Am 20. Juni 1920 kamen 200 Soldaten und ihr kemalistischer Führer Hadschi Bey nach Funtuklia. Unter dem Vorwand, uns vor anderen Türken zu schützen nahmen sie uns am nächsten Tag 3000 Lira, 3000 Schafe, 500 weitere große Tiere sowie sechs Wagenladungen voller Seidenkokons ab. Wir dachten, dass es mit diesem Lösegeld genug sei, aber am nächsten Tag nahm uns Hadschi Bey weitere 30-40000 Lire und sämtliche Tiere ab. Und dann umstellten sie das Dorf. Die Leute begannen, durch Schluchten und Rinnen zu den Bergen zu flüchten, und am Morgen des 23. Juni nahm ich meine Frau und Kinder und versuchte, an der kemalistischen Einkreisung vorbei zu entkommen.
Die Türken aber erkannten uns, setzten uns gefangen und nahm alles Geld, das ich bei mir trug, meine Kleider, meine Schuhe, die Kleider meiner Frau und der Kinder, und brachten uns ins Dorf. Sie hatten die Menschen dort eingepfercht und begannen nun, sie zu trennen, indem sie Männer über 15 Jahren in die Kirche sperrten.
So fanden sich etwa 300 Männer in der Kirche wieder und eine etwa gleiche Anzahl, zusammen mit mehreren Frauen und Kindern, wurde in das Schulhaus gesperrt, während die Hadschi Bey unterstehenden Einheiten weiterhin Männer und Frauen von den Feldern heraufschickten. In der Kirche gab es ein großes Wehklagen, und die Türken riefen:
“Warum weint ihr und betet das Kreuz an, ihr Schweine? Wir sind euer Gott, eure Jungfrau und euer Kreuz! Soll doch euer Christos kommen und eure Jungfrau herabsteigen, um euch zu retten. “
Wir flehten sie fortgesetzt an und fragten:
“Was haben wir Ihnen Böses getan, dass Sie uns abschlachten wollen? Was haben Sie von uns gefordert, dass wir Ihnen nicht gegeben haben? Was haben Sie uns befohlen, das wir nicht erfüllt haben?“
Da holten uns die Türken aus der Kirche und führten uns in den Hof. Aber ein anderer türkischer Offizier, den sie Bayram Tschawusch [Bayram Çavuş] nannten, galoppierte herbei und rief:
“Warum holt ihr die Gawurs heraus? Bringt sie wieder rein!”
Sie brachten uns zurück in die Kirche. Sie nahmen alle unsere Kleider, so dass wir barfuß, nur in unseren Unterhosen und Unterhemden waren, und führten uns dann in einer Kolonne in Richtung der Schule. Die Türken hatten in der ersten Nacht die schönsten jungen Frauen in der Schule ausgewählt und sie vor den Augen ihrer Mütter vergewaltigt. Sie wählten Mädchen ab dem Alter von zehn aus und ließ die noch Jüngeren Kerzen halten, um die Szene zu beleuchten.
Die Mädchen wollten der Vergewaltigung entgehen und lieber sterben, aber ihre Mütter hatten ihnen gesagt:
“Geh, geh mein Kind, damit sie dich nicht töten!”
Aber die Türken vergewaltigten die Frauen und Mädchen erst und dann schlachteten sie sie unter abscheulichen Foltern ab. Ihre Schreie erfüllten das ganze Dorf.
Sobald sie uns in den Schulhof gebracht hatten, der mit Frauenleichen und Fleischstücken gefüllt war, zählten sie uns, fesselten uns jeweils zu zweit aneinander und brachten uns herunter zu unseren Häusern. Sie setzten die Häuser in Brand, und als die Flammen auflohten, begannen sie, uns mit dem Messer zu schlachten oder mit Kugeln niederzustrecken.
Durch Zufall befand ich mich in der Nähe der Schultoilette und versteckte mich darin. Im Deckengebälk sah ich ein junges Mädchen von etwa 20 Jahren versteckt – Maria Karayianni – und dachte, dass sowohl sie als auch ich überleben würden. Aber die Türken bekamen Wind von ihr und holten sie herunter, gaben ihr einen Kanister Benzin, um ihn über die Türen und Fenster des Schulhauses zu gießen und setzten dann diese in Brand, nachdem sie Maria in der Schule eingesperrt hatten.
Als die Flammen aufstiegen, taumelte ich los und sprang aus dem Fenster. Aber die Türken sahen mich an und fingen an, viele Kugeln auf mich abzufeuern. Sie verwundeten mich am Hals und an der Hand. Ich taumelte ein paar Schritte und stürzte in einen Bach unterhalb der Schule und fast in die Flammen. Ich blieb dort bis es dunkelte bewusstlos liegen und als ich zu mir kam, schleppte mich zu einem Hügel. Die Gegend wurde von den Flammen taghell beleuchtet, und die Türken wanderten über die Hügel, und wen sie fanden, den brachten sie um. Aber wiederum konnten sie mich nicht finden, und ich machte mich langsam auf den Weg in die Berge von Uflak, wohin diejenigen, die das Gemetzel in unserer Stadt überlebt hatten, geflüchtet waren. In den Bergen lebten wir wie wilde Tiere an die zwei Monate, und wir töteten unsere Kinder, damit sie uns nicht durch Schreien verraten und die Türken auf uns lenkten. Wir aßen wilde Pflanzen und Wurzeln. Viele von uns waren nicht imstande, den Hunger und die Kälte zu ertragen und starben. Wir wären alle gestorben, falls nicht die Leute von Karasia uns gerettet hätten, als sie am 15. August aus den umliegenden Dörfern der Karasohoria flüchteten und sich bewaffneten, um sich vor den Türken zu retten. Diese Leute nahmen uns mit sich nach Nicomedien.
(Der Bericht erschien 1922 in einem Sammelband von Überlebendenberichten aus der Region Nicomedien, die der griechische Journalist Kostas Faltaits herausgab.)
Jakob Künzler: Die griechischen Waisen von Malatya
Der Winter von 1920 auf 21 brachte namenloses Unglück auch über die orthodoxe Bevölkerung von Zentral- und Westanatolien. War doch die Türkei im Kriege mit den Griechen. Da ward im Rat der Türken beschlossen, auch die griechisch-orthodoxe Bevölkerung des Landes zu deportieren. So wanderten endlose Züge von Mersiwan, Siwas, Konia nach Charput, Diarbekr und Bitlis. Es brach der Winter herein. Etwa 90 Prozent kamen auf der Reise um. Auf meiner ersten Reise nach Charput sah ich in den taurischen Bergen die gebleichten Knochen dieser Opfer zu Tausenden. Der N.E.R. [Near East Relief; US-amerikanisches Hilfswerk], der doch im Lande arbeitete, sammelte die Kinder, besonders viele in Malatia. Dorthin musste ich auch, um diese, 900 an der Zahl, auf den Weg zu bringen. Der Amerikaner, welcher sich dieser Kinder anzunehmen hatte, durfte ihnen nur Brot reichen und Betten geben in einem gemieteten Hause. Die Kinder zu beschäftigen, wurde nicht erlaubt. Nun ist Malatya ein Ort, wo Malaria herrscht. Jeden Tag starben mehrere Kinder. In einer Woche, da ich dort war, starben 20 dieser armen Geschöpfe. Wie kann ich diese Kinderschar auf den Weg bringen? Fragte ich mich. Die Regierung, welche hier, ungewohnterweise, gegen mich gar nicht freundlich war, verlangte erst eine Liste der Kinder, welche gehen sollten. Deren Gesundheitszustand entsprechend, teilte ich sie in drei Gruppen. Die gesunden Kinder sollten auf Maultierrücken über die Berge nach Süden gelangen, eine zweite, schwächere Gruppe hoffte ich per Wagen via Diarbekr zu senden und endlich die halbtoten Kinder in Automobilen auf den Weg bringen zu können. Große Mühe machte mir, des Griechischen Unkundigen, die Aussprache der merkwürdigen Namen. Da hieß ein Mädchen Netsemane Karalambos [Charalampos], ein Junge Karalambos Netsemanos, ein anderes Mädchen Nordane Arestaki, ein anderer Junge aber Arestaky Nordanos usw.

Angehörige der kemalistischen „Befreiungs“-Streitkräfte mit ihrem aufgehängten Opfer, eine enthauptete und
verstümmelte griechische Lehrerin in Nazili (Vilayet Aydın), 5. Juni 1920.
Fotografiert am 15. Juni 1920 von N. Rigopoulos (Archiv: Nikolaos Hlamides)
Die erste Gruppe war glücklich auf Maultieren auf den Weg gebracht. Da aber die erwarteten Wagen gar nicht kommen wollten, der Herbst bereits ins Land gezogen war, musste ich mich entschließen, die zweite Gruppe auch noch per Maultier auf den Weg zu bringen. Das Schlimmste aber war, dass täglich Kinder der zweiten Gruppe aufs Schwerste erkrankten, andere der dritten Gruppe aber sich erholten und ich sie, da ich nur ein Automobil zur Verfügung haben konnte, zur zweiten Gruppe schlagen musste. Dies gab dann wieder Schwierigkeiten mit der Polizei, welche doch die Pässe nach meinen Listen zurechtmachte.
Endlich kamen denn noch etwa 10 Wagen. In diese verstaute ich die schwachen Kinder und sandte sie nach Charput. Ich selbst reiste am andern Tage mit dem Reste, etwa 12 Kindern, im Auto nach Charput ab. Einen kleinen Jungen, bereits schon in der Todesagonie, nahm ich auf meinen Schoss, da sonst gar kein Platz im überfüllten Auto war. Nach einer Stunde Fahrt hatte er seinen Geist auf meinen Knien aufgegeben. Da ich ihn aber nirgends hinlegen konnte, erkaltete er auf mir. Nach drei Stunden Fahrt langten wir in Charput an, wo ich mich der seltenen Last entledigen konnte.
Aus: Jakob Künzler: Im Landes des Blutes und der Tränen: Erlebnisse in Mesopotamien während des Weltkrieges (1914-1918). Potsdam: Tempelverlag, 1921 (Neuausgabe hrsg. von Hans-Lukas Kieser, Zürich: Chronos, (1999), S. 177 f.
Aus einem Bericht an den Ehrenwerten Staatssekretär Charles E. Hughes, in Washington, USA, von Jamor F. D. Yowell, ehemaliger Direktor der Filiale Harput des Near East Relief, verfasst vor dem 5. Mai 1922
Ein Amerikaner, dessen Name ich aus verständlichen Gründen nicht nennen kann, zählte im vorigen Dezember 1.500 tote Griechen auf der Straße zwischen Sivas und Malatya; ein anderer zählte 128 tote Griechen zwischen Malatya und Harput und war häufig gezwungen, mit seinem Lastwagen den auf der Straßen liegenden Leichen auszuweichen. Ich habe persönlich Hunderte griechischer Leichen unbeerdigt und von Hunden sowie Geiern zerfressen gesehen. Die Muslime machen sich nicht die Mühe, die Leichen toter Christen zu beerdigen, und die lebenden Christen besitzen nicht mehr die Kraft, dieses Ritual zu vollziehen, selbst wenn man es ihnen gestatten würde.
Zitiert nach: Gibbons, Herbert Adams: Near East Relief prevented from helping Greeks. “Christian Science Monitor“, Boston, 13. Juli 1922
Aus einem Artikel von Herbert Adams Gibbons aus Konstantinopel, 31. Mai 1922, erschienen im “Christian Science Monitor“, Boston, den 13. Juli 1922 unter der Überschrift: “Das Near East Relief wurde daran gehindert, Griechen zu helfen“
Ein Amerikaner, der sich vom Oktober 1921 bis Mai 1922 in Sivas aufhielt, sah, wie die Deportierten seit dem Herbst dort durchzogen, vermutlich auf ihrem Weg nach Harput. Sie stammten nicht nur aus der Samsungegend, sondern aus allen Dörfern und Städten des nördlichen Kleinasien. Den ganzen Winter hindurch trafen sie ein, in einem unbeschreiblichen Zustand von Schmutz und Erschöpfung. Den Amerikanern wurde die Erlaubnis, irgendetwas für die Griechen zu tun, glatt abgelehnt. Schließlich stimmte der Gouverneur Haidar Bey zu, dass die Amerikaner Frauen und Kindern sowie Jungen unter fünfzehn Jahren helfen durften, jedoch nicht älteren Jungen und Männern, die nach Erzurum zur Straßenarbeit geschickt wurde. Das war aber bloß ein Vorwand. Der Schnee lag hoch. Sie waren ohne Unterkunft, und die meisten starben an Kälte.
Außerhalb von Sivas gab es ein Deportiertenlager, wo Scheunen ohne Dächer oder Fenster und Türen, nur aus Palisaden bestehend, den einzigen Schutz boten. Kein Near East Relief-Mitarbeiter durfte sich dem Lager nähern. Die Kranken wurden in die Stadt gebracht und in die armenische Kirche geworfen, die eine amerikanische Mitarbeiterin das ‚schwarze Loch von Kalkutta’ nannte. Sie schränkte allerdings ein, dass das eigentliche Schwarze Loch nicht so schlimm sein könne. Denn in dieser Kirche, deren Fenster mit Brettern vernagelt waren, und wo es dunkel und feucht war, wurden alle Arten der schrecklichsten Seuchen hineingetragen und sich selbst überlassen. Die Amerikaner durften rein gar nichts für diese Menschen tun. Sie gingen sämtlich zugrunde. Für keinen einzigen bestand die Möglichkeit zur Rettung. Ihre Körper werden nicht entfernt.
Die US-amerikanische Ärztin und Frauenrechtlerin Dr. Esther Clayson Pohl Lovejoy über ihre Erlebnisse auf den Quais von Smyrna, September 1922:
Ich war die erste amerikanische Rot-Kreuz-Frau in Frankreich. Aber was ich während des Weltkrieges sah, scheint ein Liebesfest zu sein im Vergleich mit den Gräueln von Smyrna. Als ich in Smyrna eintraf, waren auf den Kais 250.000 Menschen zusammengedrängt– erbarmenswert, leidend und schreiend, darunter geschlagene Frauen mit vom Leib gerissenen Kleidern, getrennte Familien und alle ausgeraubt. Da sie wussten, dass ihr Leben von einer Flucht vor dem 30. September abhing, verharrten die Mengen am Wasser zusammengedrängt – so eng, dass kein Platz blieb, um sich hinzulegen. Die Sanitärverhältnisse waren unaussprechlich.
Dreiviertel der Menge bestand aus Frauen und Kindern, und nie habe ich so viele schwangere Frauen gesehen. Es schien, dass jede zweite Frau in anderen Umständen war. Die Flucht und Umstände führten zu zahlreichen Frühgeburten, und auf dem Kai, wo es kaum Platz gab, um sich hinzulegen, und ohne Hilfe wurden die meisten der Kinder geboren. In den fünf Tagen, die ich dort war, erfolgten über 200 solcher Niederkünfte.
Noch herzzerreißender waren die Schreie der Kinder, die ihre Mütter, oder der Mütter, die ihre Kinder verloren hatten. Sie wurden durch den großen, bewachten Verhau getrieben, und es war unmöglich, zu den Verlorenen zurückzukehren. Mütter kletterten mit der Kraft des Wahnsinns fünf Meter hohe Stahlzäune empor und suchten trotz der Schläge mit Gewehrkolben in ihre Gesichter nach ihren Kindern, die wie Tiere schreiend umherjagten.
Der Zustand, in dem diese Menschen die Schiffe erreichten, lässt einen zweifeln, ob das Entkommen besser als die türkische Deportation war. Nie zuvor hat man solche systematische Räuberei gesehen. Die türkischen Soldaten durchsuchten und beraubten jeden einzelnen Flüchtling. Jegliche Kleidung und Schuhe von einigem Wert wurden ihnen vom Körper gerissen.
Um die Männer auszurauben, wurde eine andere Methode benutzt. Den Männern im Wehralter wurde gestattet, durch alle Sperren bis auf die letzte mithilfe von Schmiergeldern zu gelangen. Bei der letzten Sperre wurden sie zurückgeschickt, um deportiert zu werden. An der Ausplünderung beteiligten sich nicht nur Soldaten, sondern ebenso Offiziere. Ich kann zwei krasse Fälle bezeugen, die von Offizieren begangen wurden, die man sonst als Herren eingestuft hätte.
Am 28. September trieben die Türken die Mengen von den Kais, wo die Scheinwerfer der alliierten Kriegsschiffe auf ihnen lagen, in die Seitenstraßen. Die ganze Nacht durch waren die Schreie der Frauen und Mädchen zu hören, und am nächsten Tag wurde erklärt, dass viele von ihnen zu Sklavinnen gemacht wurden.
Der Schrecken von Smyrna liegt jenseits aller Vorstellungskraft und der Macht des Wortes. Es handelt sich um ein Verbrechen, für das die ganze Welt Verantwortung trägt, weil sie durch sämtliche Zeitalter der Zivilisation hindurch nicht in der Lage war, wenigstens einige Mittel zu entwickeln, um solche Befehle wie die Evakuierung einer ganzen Stadt und die Mittel, mit denen diese ausgeführt wurden, zu verhindern. Es ist ein Verbrechen, das die Welt infolge ihrer Auffassung von Neutralität verübt hat und womit sie diese Ausschreitung gegen 200.000 Frauen zugelassen hat.
Unter dem Befehl, neutral zu bleiben, beobachtete ich den Start eines amerikanischen Kriegsschiffes, um zwei männliche Flüchtlinge aufzugreifen, die versuchten, unter dem türkischen Gewehrfeuer zu einem Handelsschiff zu schwimmen und die in die Hände der am Strand wartenden türkischen Soldaten ausgeliefert wurden, was ihr sicherer Tod sein musste. Und unter dem Befehl, neutral zu bleiben, sah ich Soldaten und Offiziere sämtlicher Staatszugehörigkeiten untätig bleiben, während türkische Soldaten mit ihren Gewehren Frauen schlagen, die versuchten, zu ihren Kindern zu gelangen, die außerhalb des Zaunes weinten.
Quelle: Woman pictures Smyrna horrors: Dr. Esther Lovejoy, an eyewitness, tells of terrible scenes on the Quay; she assails neutrality; declares it a crime for the world to lack the means to prevent such outrages. – “The New York Times”, October 9, 1922, S. 3; Asserts atrocities in Smyrna continue: Dr. Esther Lovejoy describes systematic robbery and outrages by troops. “The New York Times”, October 2 1922, S. 47. –
Internet Fundstelle: http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9D01EFDC1E39EF3ABC4B53DFB6678389639EDE
Ionien, Oktober 1922: Deportation griechisch-orthodoxer Männer
Gegen Mittag hörten wir großen Lärm. Die Tür des Schuppens öffnete sich und mit Geschrei ergoss sich das neue Etwas zu uns herein. Anfangs erschraken wir, gaben uns Mühe zu ahnen, was das für Gestalten wären. Dann erkannten wir sie voller Verwunderung: Mensch!
Es war eine dichte Masse von Bäuchen, die sich anfangs hereinschob, die einen splitternackt, die anderen verhüllt von langen leinenen Unterhosen, die an den lehmbedeckten Füßen ganz zerschlissen waren. Dann kamen die Köpfe, Augen, Zöpfe, Bärte, dichte Wollknäuel, als kämen sie von einer Rauferei.
Mensch, unsere Popen!
Es waren an die dreißig, alle die ‚Alten‘ von Aiwali. Nur um einige wenige wogten noch gewisse Überreste ihrer Kutten herum. Ein paar trugen noch, schief und zerbeult von Schlägen, ihre Kopfbedeckung. Die anderen waren nackt bis auf die Unterhemden und die Unterhosen.

September 1922: An den Kais der niedergebrannten christlichen Stadtteile Smyrnas
drängen sich zahlreiche griechische Einwohner, vor allem Frauen und Kinder.
Foto: Near East Relief
Sie warfen sich nieder und schrien alle zusammen von Schmerzen. Dann stürzten sie sich, vom Hunger getrieben, auf die gesalzenen Fische. Sie packten die Sardellen und schlangen sie mit den Schuppen herunter, tranken dann kübelweise Wasser, immer und immer wieder.
Nur zwei rührten sich dort, wo sie niedergefallen waren, nicht mehr: eine sanfte schmächtige Gestalt und ein Greis, der über siebzig war. Sie stöhnten.
Die Popen hatten einen Tag nach uns denselben Weg zurückgelegt. Wir fragten sie nach Neuigkeiten. Sie kamen nicht dazu, uns zu berichten. Die Eskorte erschien. Sie hießen uns zum Weitermarsch aufstehen. Wir hatten uns durch den Nachtschlaf und das Brot etwas erholt. Aber die Priester waren beklagenswert. Vor allem die zwei wollten sich nicht erheben. Man zwang sie dazu.
Wir machten uns auf den Weg. Links glänzte die Akropolis von Pergamon – Attalos III., der von seiner Frau geschieden war…
Der Zug hielt an. Ein Durcheinander. Die Soldaten fluchten, schrien. Der alte Pope wollte nicht mehr weitergehen. Er fiel. Stützt ihn zu zweit unter den Armen!, befahl der Anführer. Wir fassten ihn zu zweit unter den Achseln und zogen weiter. Aber seine Füße blieben zurück, schleiften. Wir hielten wieder. Der Unteroffizier kam außer sich von hinten heran. Mit dem Lauf des Gewehrs versetzte er ihm ein paar Stöße in die Hüfte, um ihn zu sich zu bringen. Er wurde schwer, entglitt unseren Händen und fiel hin. Die Soldaten sahen ihn von oben bis unten an, zogen ihn an den Straßenrand, ließen ihn dort aufs Gesicht fallen und stießen mit den Kolben auf ihn ein. Er stöhnte nicht einmal. Nur mit der Zunge leckte er die Erde, als wolle er versuchen, ob sie salzig oder bitter sei.
Von dem Hügel, gegenüber der Burg des Attalos, wenige Meter von uns entfernt, rutschten Türkenkinder, die dort spielten, in die Szene herab. Die Soldaten zogen sich zurück, um weiterzumarschieren. Die Kinder begannen alle zusammen den Körper, der sein Leben aushauchte, aus der Nähe mit Steinen zu bewerfen.
Noch eine Zeitlang hörten wir den dumpfen Schlag der Steine, die sich immer mehr aufhäuften. Dreimal hatte er mir, als ich klein war, das Heilige Abendmahl gereicht.
Aus dem autobiographischen Bericht des Schriftstellers Elias Venezis: Nr. 31328: Leidensweg in Anatolien. Mainz 1969, S. 73-75
Der Autor stammte aus der ionischen Stadt Aivali (griech. Kydonies) und wurde im Alter von 18 Jahren zur Zwangsarbeit deportiert.